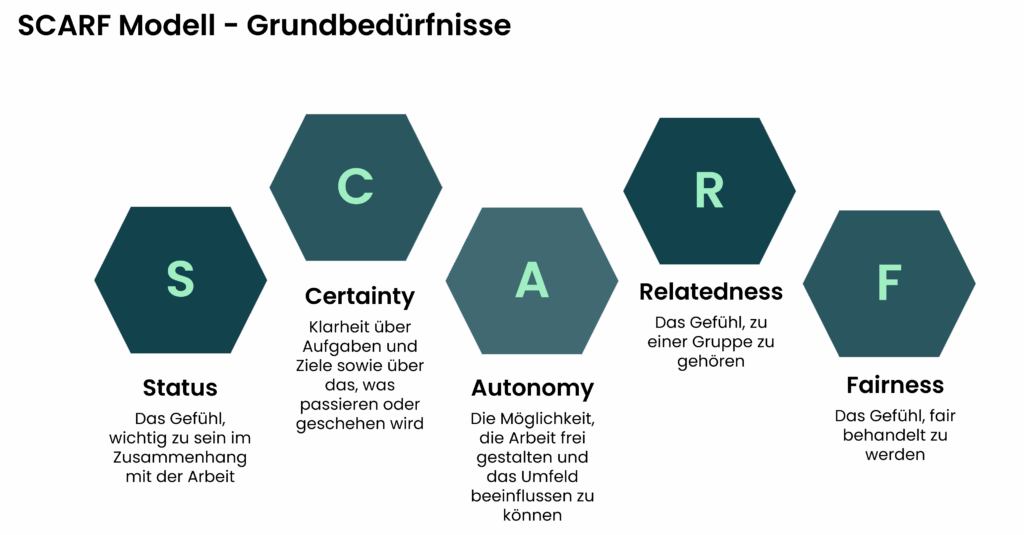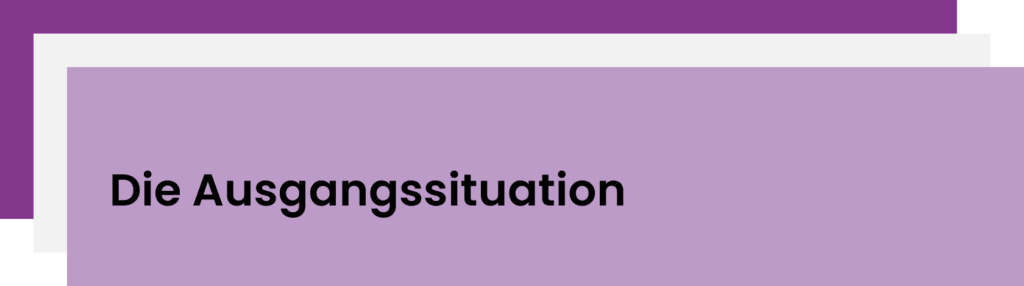
Transformationsimpulse aus dem neuen Koalitionsvertrag
-
Bürokratieabbau
Das Thema Bürokratieabbau ist zwar ein Dauerbrenner unter den politischen Schlagworten, doch diesmal stehen die Zeichen gut, dass die Bundesregierung es mit ihren Ambitionen ernst meint. So soll es ein Bürokratieabbauziel von 25 % geben, auf das jedes Ressort einzahlen muss. Neben der politischen Bürokratie durch Gesetze und Verordnungen gibt es auch innerhalb der Behörden viel Potenzial für schlankere Abläufe - definitiv ein zentrales Thema für die Organisationsentwicklung.
-
Bündelung von Ämtern und Einheiten
Neben Verschlankungen in den Prozessen kündigen sich auch aufbaustrukturelle Reformen an. Die Regierung plant, die Zahl der Bundesbehörden durch Zusammenlegungen zu reduzieren. Auch sollen Service-Einheiten für querschnittliche Aufgaben wie Personal oder IT übergreifend gebündelt werden.
-
Moderne Führung und Kultur
Auch einen Kulturwandel in der Verwaltung hat die Bundesregierung sich auf die Fahne geschrieben, insbesondere in Bezug auf das Führungsverständnis. Wertschätzung, zielorientierte Führung und das Ausschöpfen von Handlungsspielräumen stehen im Fokus. Dafür wird es Programme zur Führungskräfteentwicklung brauchen.
-
Übergreifende Zusammenarbeit
Die Regierung möchte weg von einem Denken in Einzelressorts und hin zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Dafür sollen unter anderem ministeriumsübergreifende Projektteams gestärkt werden. Auch im Führungsverständnis soll das ressortübergreifende Denken verankert werden.
-
Flexibleres Personalmanagement
Um den öffentlichen Dienst attraktiver und flexibler zu machen, ist eine Reihe von Neuerungen geplant: Laufbahnwechsel werden vereinfacht, Quereinstiege abseits juristischer Ausbildungen ermöglicht und Vergütungen leistungsorientierter gestaltet. Im Fokus steht die Gewinnung verwaltungsexterner Fachkräfte. Auch flexiblere Arbeitszeiten und Führung in Teilzeit sollen zur Attraktivität beitragen.