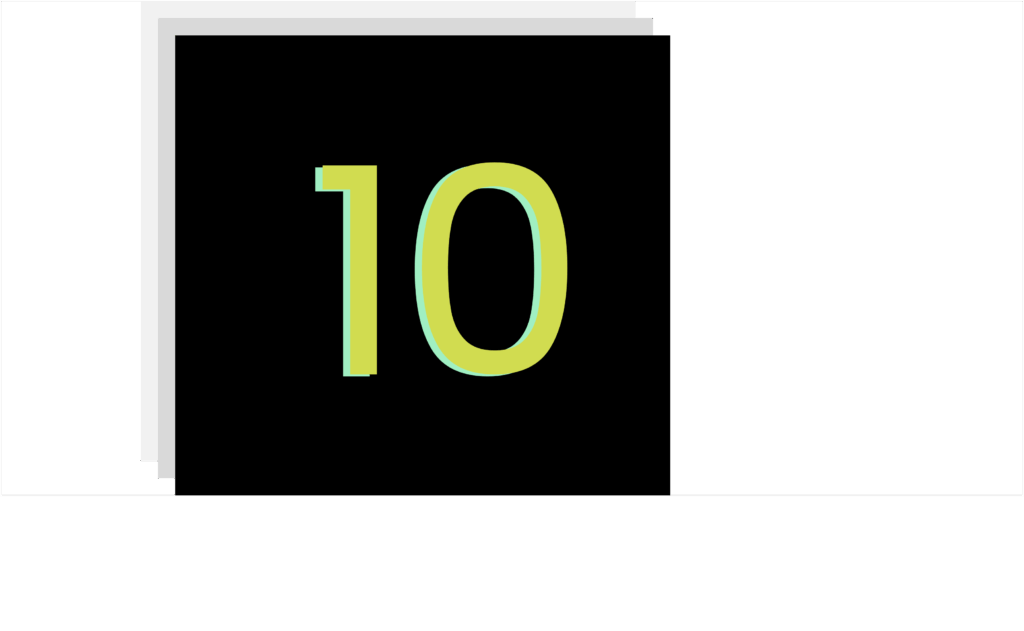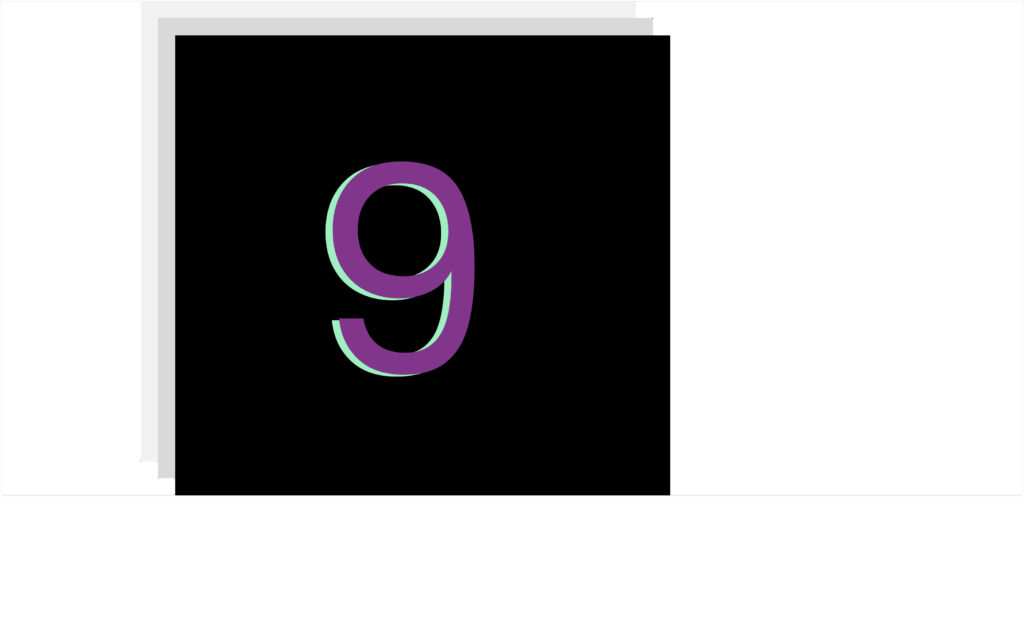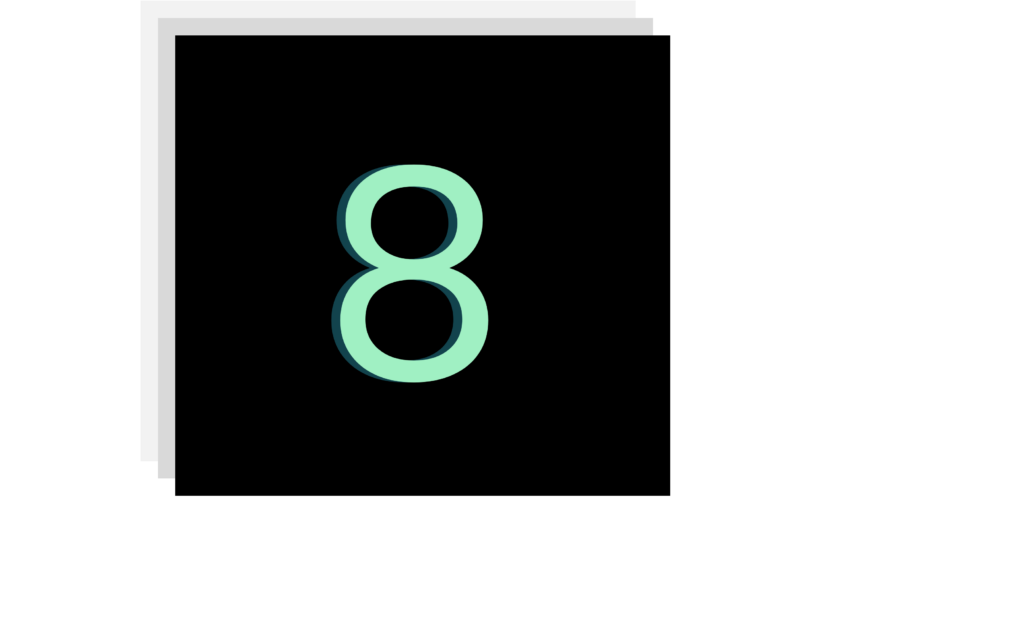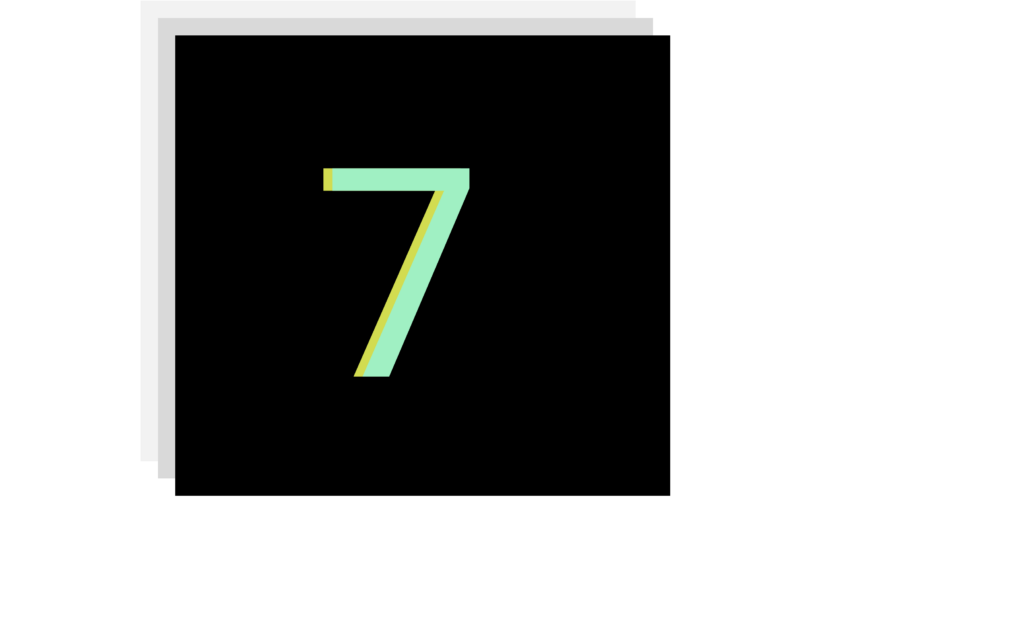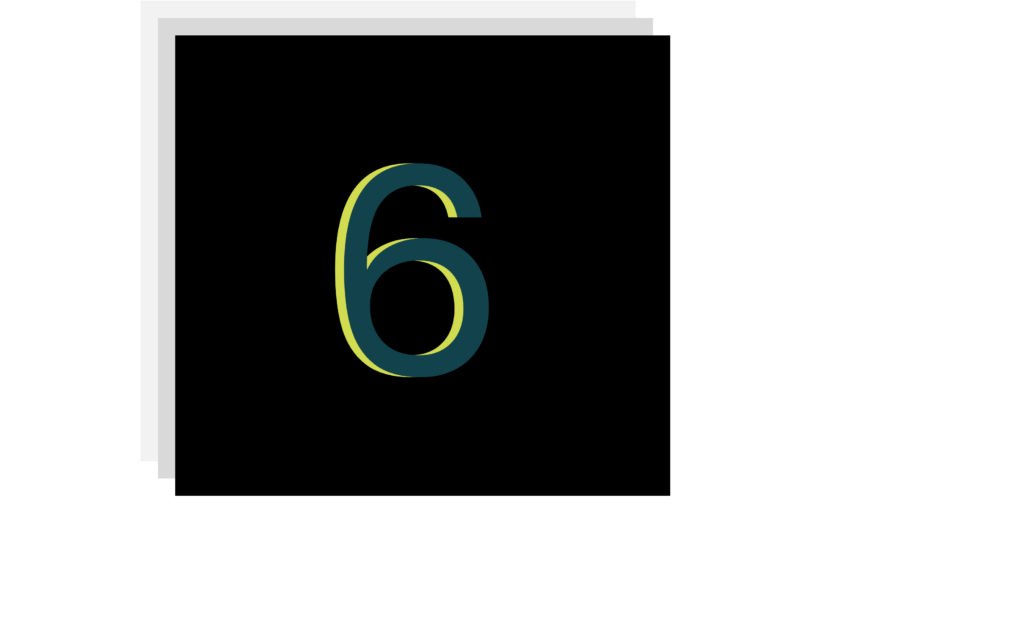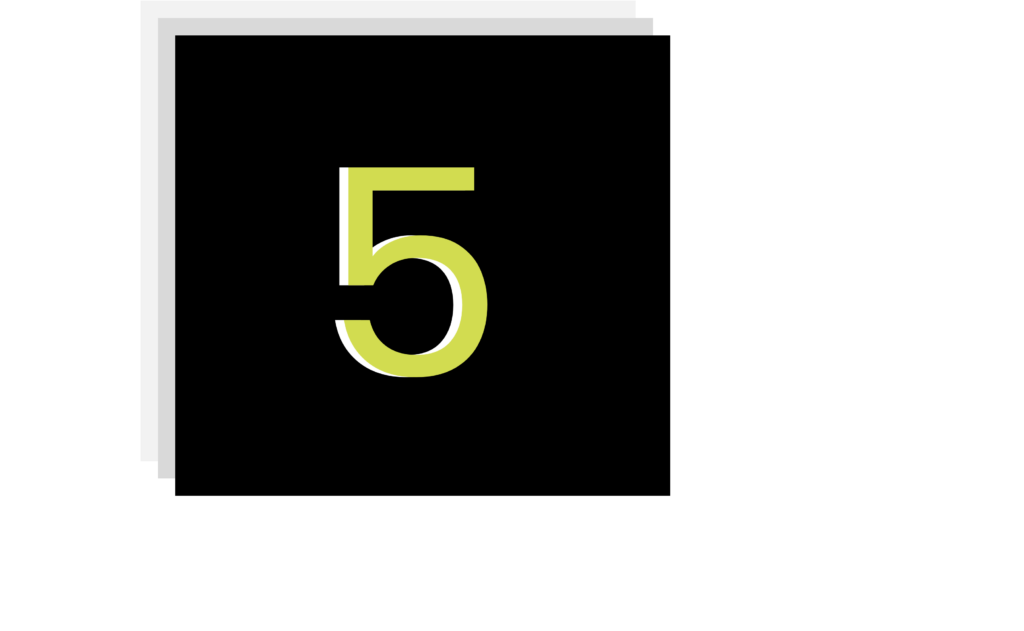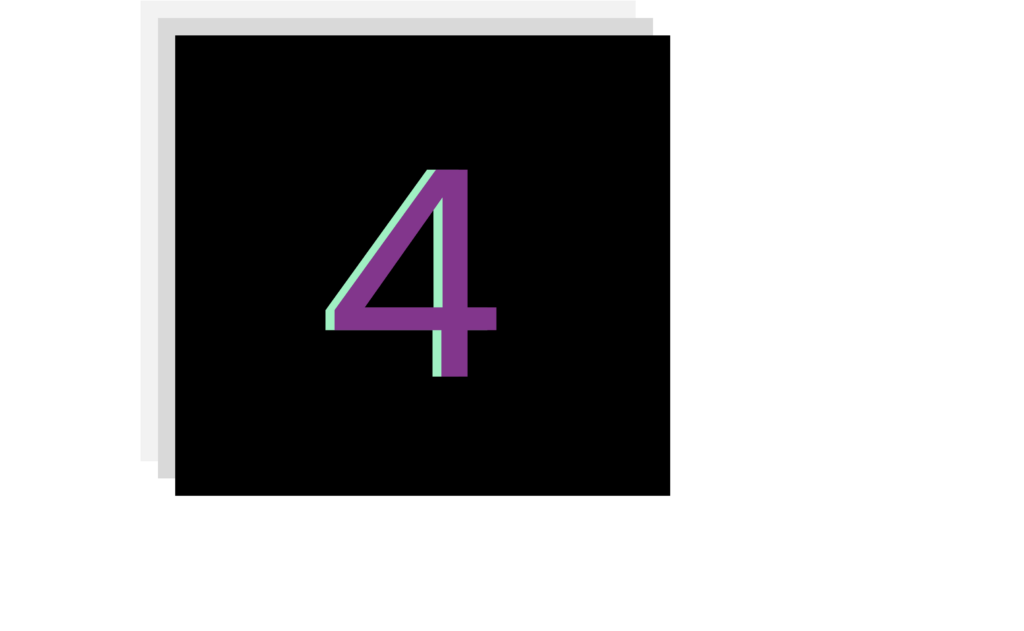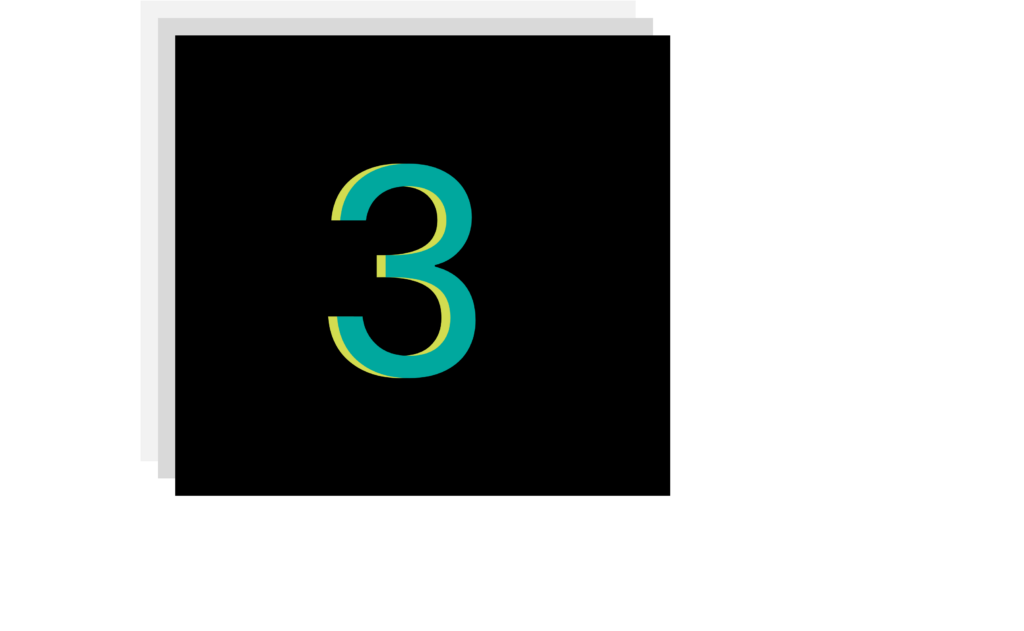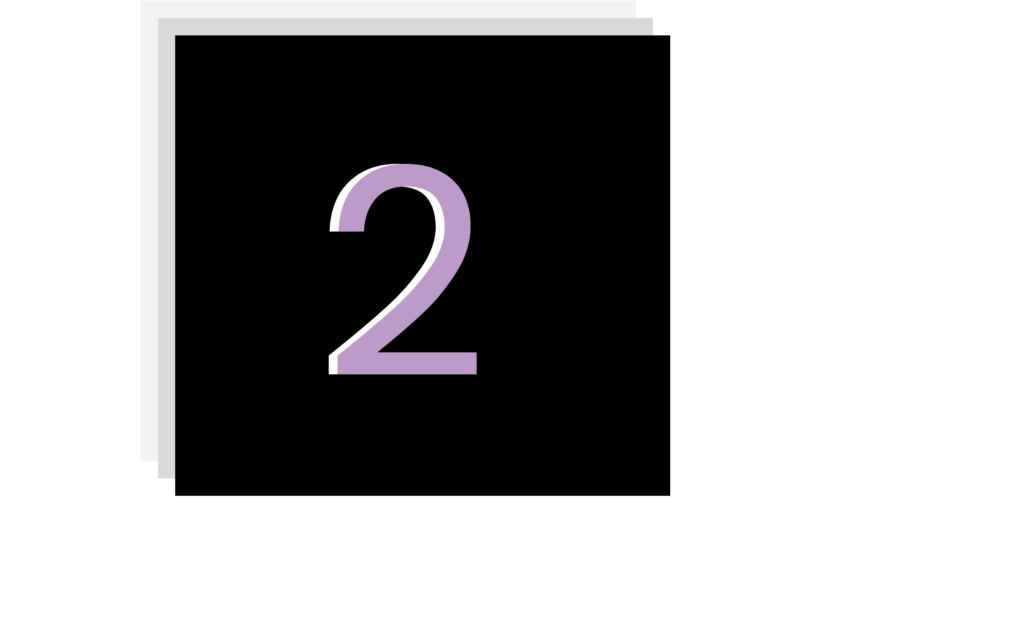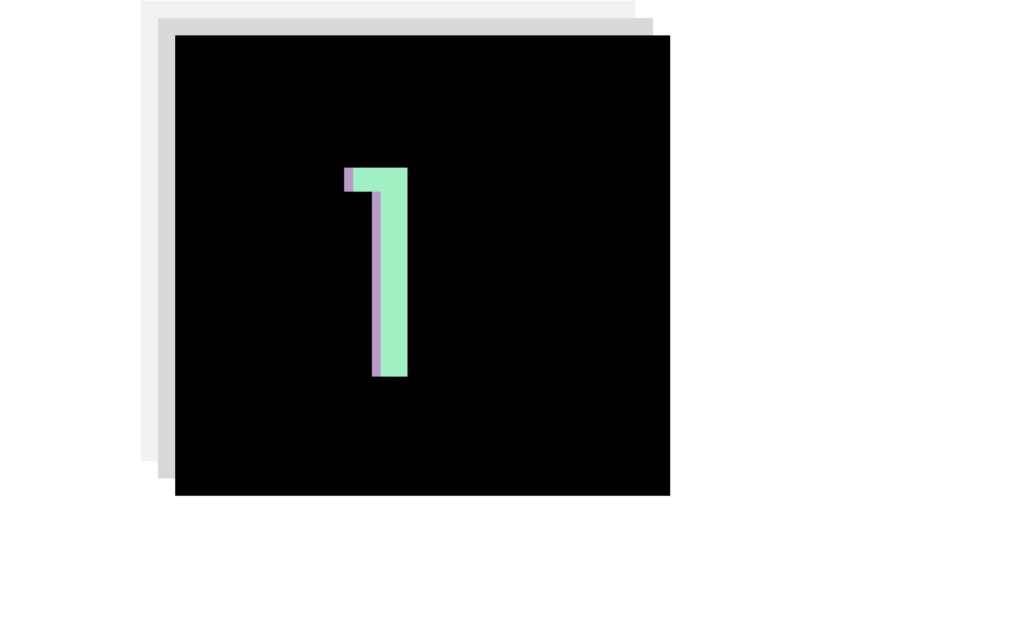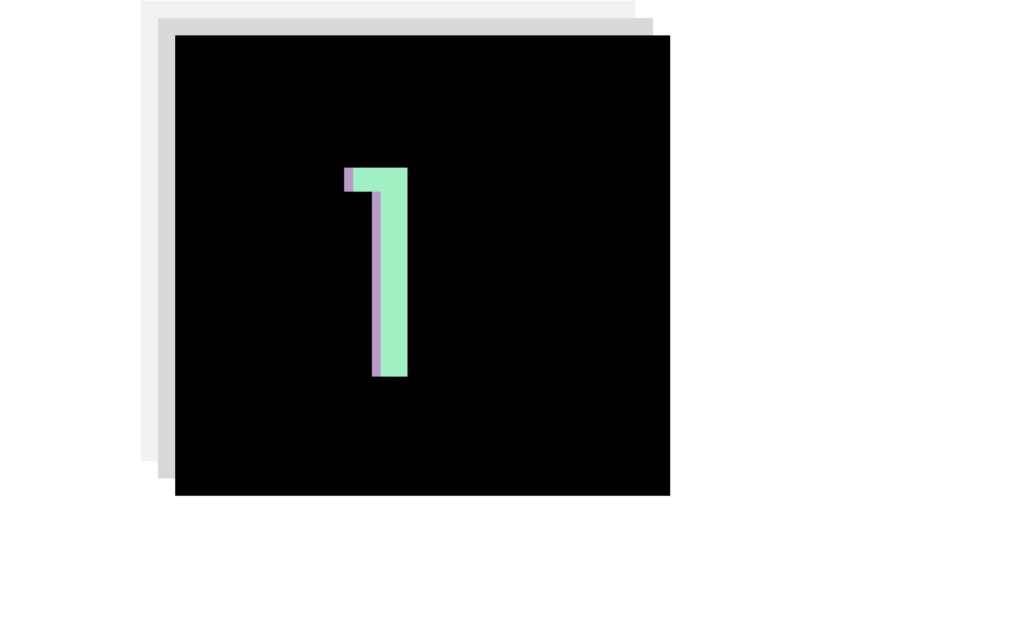
Organisationstheorie-Klassiker für die Praxis (1): Nils Brunsson und die organisierte Heuchelei
Theorie hat in Organisationen keinen guten Ruf. „Das ist doch bloß Theorie“ oder „Das ist zu akademisch“ durfte sich wahrscheinlich jeder Organisationsberater schon einmal anhören. Organisationen wollen eindeutige, greifbare und handlungsleitende Aussagen, daher wird der Begriff „Theorie“ selten mit einer positiven Konnotation genutzt. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass Organisationstheorie dabei hilft, das Geschehen in Organisationen zu verstehen und dadurch einen immensen Mehrwert bietet. Um eine Lanze für die Theorie zu brechen, werde ich in den kommenden Monaten in loser Folge einige Klassiker der Organisationswissenschaft vorstellen – immer verbunden mit dem Blick darauf, wie sich theoretische Betrachtungen in der Praxis widerspiegeln. Die Auswahl hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern basiert darauf, welche Autor:innen bzw. Werke ich persönlich dafür schätze, dass sie einen überraschenden Blick bieten und gängige Annahmen hinterfragen.
Den Anfang macht der von mir hoch verehrte Soziologe Nils Brunsson. Brunsson schafft es wie kein Zweiter, das Eigenleben von Organisationen zu beschreiben, das selten so geordnet und rational ist, wie es häufig dargestellt wird. Sein wohl wichtigstes Konzept ist die Unterscheidung zwischen „talk“ und „action“ – Brunsson zeigt, dass zwischen den offiziellen Aussagen der Organisationsführung und dem, was real in der Organisation geschieht, deutliche Diskrepanzen bestehen: Nicht alles, was gesagt werden kann, ist umsetzbar (oder soll umgesetzt werden), und nicht alles, was getan wird, kann bzw. darf gesagt werden. Die unterschiedlichen Stakeholder stellen widerstreitende Erwartungen an die Organisation – bspw. ethisches Handeln und wirtschaftliche Effizienz –, was die Organisation dadurch löst, dass sie das eine sagt und das andere tut. Brunsson spricht daher von der „organization of hypocrisy“ – wobei er den Begriff der Heuchelei nicht in einem moralischen Sinne verwendet, sondern im Gegenteil argumentiert, dass Organisationen ohne ein gewisses Maß an Heuchelei nicht funktionsfähig wären.
Die Theorie der Heuchelei mag zynisch erscheinen, ist jedoch höchst aufschlussreich und praktisch häufig erkennbar – etwa, wenn Organisationen sich Leitbilder für nachhaltiges Handeln geben, die in der Praxis unterlaufen werden. Als Organisationsmitglied ist es natürlich schwierig, mit dem beschreibenden soziologischen Blick auf die Organisation zu schauen, sodass die Kluft zwischen talk und action ein Hauptgrund für Frustration ist. Aus Brunssons Arbeit lässt sich jedoch ableiten, dass Organisationen nicht gut beraten wären, die Umsetzung von Entscheidungen durch kleinteilige Kontrolle zu erzwingen, oder gegenüber ihren Stakeholdern maximale Transparenz über ihre Aktivitäten anzustreben.