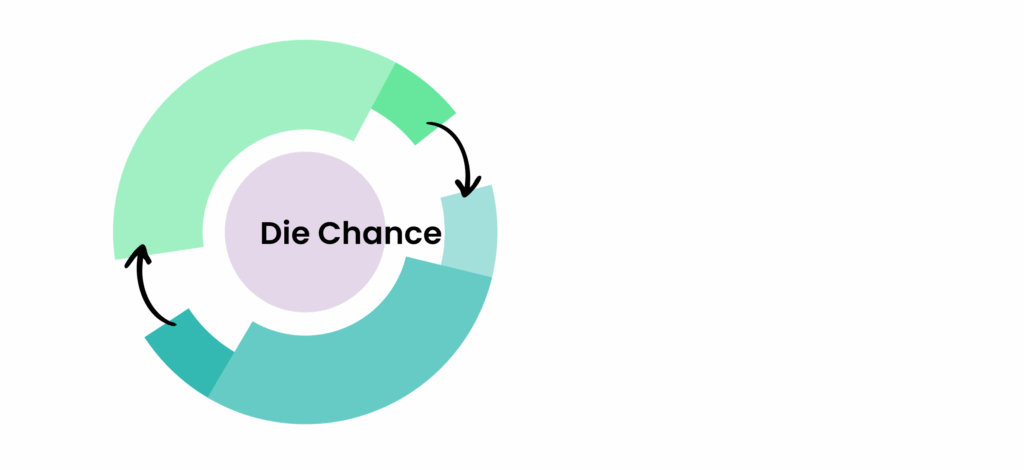In Zeiten knapper öffentlicher Mittel kommt es mehr denn je darauf an, dass Fördergelder gezielt und wirksam eingesetzt werden. Viele Förderprogramme schöpfen ihr Wirkungspotenzial jedoch noch nicht aus. Warum das so ist – und wie es besser geht – zeigt dieser Beitrag.

Senior Consultant
flatters@imap-institut.de
+49 (0) 211 513 69 73 - 30
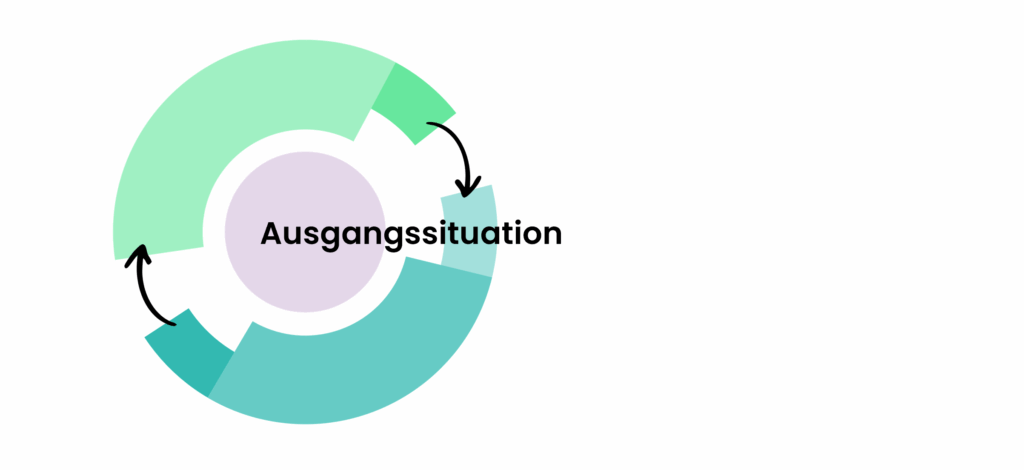
1. Wirkungsorientierung ist politisch gewollt und gesetzlich verankert
Wirkungsorientierung ist längst nicht mehr nur eine methodische Empfehlung – sie ist politischer Auftrag. Dazu haben sich sowohl die alte, als auch die neue Bundesregierung in ihren Koalitionsverträgen bekannt.
Auch gesetzlich ist der Anspruch eindeutig formuliert: Die Bundeshaushaltsordnung (§7 BHO) verpflichtet zu einer Erfolgskontrolle, die sich nicht nur auf Wirtschaftlichkeit, sondern auch auf Zielerreichung und Wirkung bezieht. Vergleichbare Vorgaben finden sich in den Haushaltsordnungen der Länder.
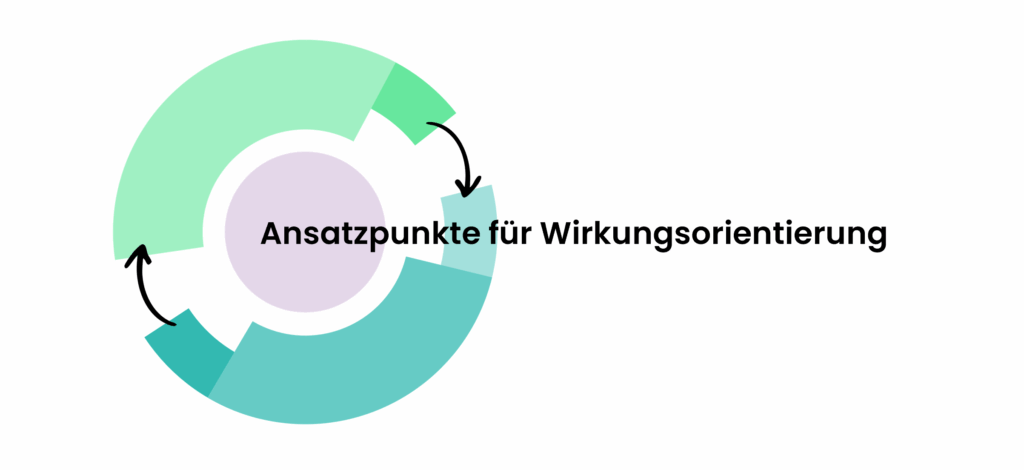
2. Förderprogramme: ein starker Hebel – oft schwach genutzt
Das Handeln öffentlicher Akteure an gesellschaftlich relevante Zielsetzungen sowie Zielgruppen und ihre Bedarfe auszurichten ist also nicht nur per se ein sinnvoller Anspruch sondern auch politisch gewollt. Und gerade Förderprogramme bieten vielfältige Möglichkeiten, wirkungsorientiert zu steuern. Sie adressieren gesellschaftliche Herausforderungen direkt, setzen finanzielle Anreize und können – bei kluger Gestaltung – Lernprozesse anstoßen und Innovationen verbreiten.
Doch in der Praxis bleiben diese Potenziale häufig ungenutzt.
Warum Hebel ungenutzt bleiben
Ziele sind oft vage oder wenig ambitioniert
zum Beispiel wenn sie sich auf reine Outputgrößen wie die Anzahl der Teilnehmenden beschränken, statt tatsächliche Veränderungen (Outcomes oder Impacts) in den Blick zu nehmen.
Indikatorensysteme fehlen oder sind unzureichend
viele Projektträger müssen eigene Messkriterien entwickeln, obwohl längst etablierte Indikatoren existieren, die sie einfach adaptieren könnten.
Förderrichtlinien, Antragsformulare und Auswahlkriterien sind häufig nicht aufeinander abgestimmt
die Kohärenz zwischen Programm- und Projektebene geht verloren und damit die Treffsicherheit in der Förderung der richtigen Projekte.
Programme arbeiten selten mit expliziten Wirktheorie
obwohl diese helfen würden, klare Annahmen zu formulieren und Lernprozesse zu ermöglichen.
Berichtsformate erzeugen wenig Erkenntnisgewinn
Sie fokussieren auf administrative Details und abrechenbare Leistungen – nicht auf Lernfortschritte oder tatsächliche Wirkungen.
Digitalisierungspotenziale bleiben ungenutzt
Statt intelligenter Datenplattformen dominieren nach wie vor PDF-Formulare, Papierberichte und gescannte Unterschriftenseiten.
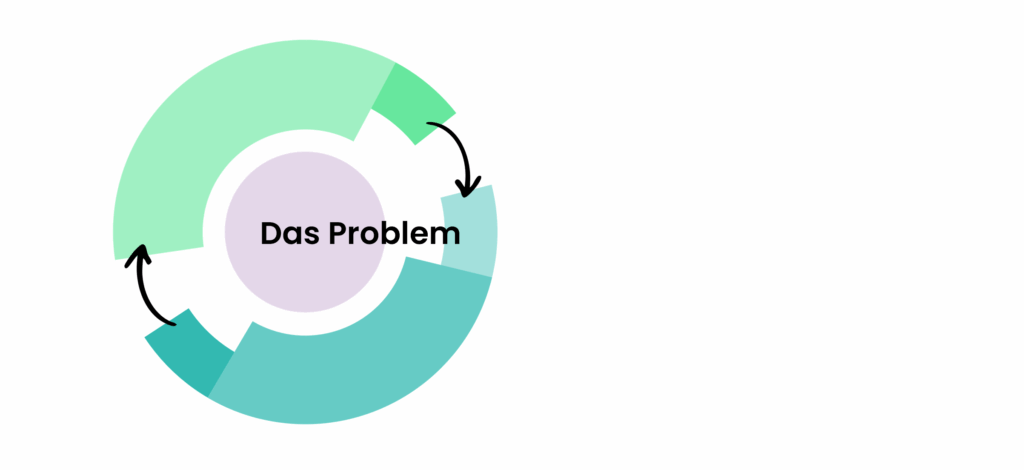
3. Was erschwert die Umsetzung von Wirkungsorientierung?
Die Herausforderungen bei der Umsetzung liegen nicht nur in mangelnden Ressourcen oder fehlendem Know-how. Vielmehr müssen zentrale Spannungsfelder adressiert werden, die tief in der Logik der Projektförderung selbst verankert sind:
Zentrale Spannungsfelder
Innovation und Planungssicherheit – ein echtes Dilemma
Projektförderung will Freiraum für neue Ansätze bieten. Gerade deshalb wird häufig darauf verzichtet, Ziele und Indikatoren zu Beginn präzise zu definieren. Doch ohne klare Zielrichtung verliert sich das Programm in der Beliebigkeit – und der Steuerung fehlt das Fundament. Wirkungsorientierung verlangt hier ein sensibles Gleichgewicht: Sie soll nicht Innovation beschneiden, sondern ihr eine nachvollziehbare Richtung geben.
Flughöhe: Wie konkret darf es sein?
Ziele und Indikatoren müssen gleichzeitig zwei Anforderungen erfüllen: Sie sollen den Projekten vor Ort helfen, sich zu strukturieren und ihre Fortschritte zu messen. Gleichzeitig müssen sie so gestaltet sein, dass man Erfolge verschiedener Projekte gemeinsam betrachten kann – etwa um den Austausch unter Projektträgern zu unterstützen, zur gemeinsamen Weiterentwicklung und Rechenschaftslegung. Diese doppelte Funktion ist anspruchsvoll: Zu allgemeine Formulierungen bleiben folgenlos, zu spezifische Vorgaben werden den vielfältigen Realitäten der Projektarbeit nicht gerecht. Gute Zielsysteme müssen daher sorgfältig austariert sein – anschlussfähig und gleichzeitig differenzierungsoffen.
Das Förderdickicht: Koordination statt Überforderung
Viele Träger sind in mehreren Förderprogrammen gleichzeitig aktiv – oft von verschiedenen Ressorts, verschiedenen Ebenen des föderalen Staats, teils von Stiftungen oder Spenden unterstützt. Die Anforderungen an Berichterstattung, Indikatoren und Nachweise unterscheiden sich erheblich. Das führt zu Mehraufwand, Verwirrung und Frustration. Die eigentliche Arbeit – das Erreichen gesellschaftlicher Wirkungen – tritt dabei leicht in den Hintergrund. Wirkungsorientierung bietet eine Gelegenheit zur Koordination: Programmverantwortliche brauchen ein Bewusstsein für die Zielsysteme anderer Fördergebender im selben Themenfeld. Wo es inhaltliche Überschneidungen gibt, sollten ähnliche Dinge auch ähnlich gemessen werden. Und wo Programme unterschiedliche Schwerpunkte setzen, sollten diese bewusst voneinander abgegrenzt werden.
Sorge vor Zahlen und einer Geringschätzung von qualitativen Ergebnissen
Nicht zuletzt gibt es Berührungsängste: Viele fürchten, dass Wirkungsorientierung auf reine Quantifizierung hinausläuft – und damit wichtige qualitative Aspekte verloren gehen. Tatsächlich aber ist das Gegenteil richtig: Gute Wirkungsorientierung kombiniert qualitative und quantitative Perspektiven. Getreu einem Albert Einstein zugeschriebenen Motto: „Nicht alles, was man zählen kann, zählt – und nicht alles, was zählt, kann man zählen“. Es braucht ein breiteres Verständnis von Evidenz, das auch subjektive Erfahrungen, Prozessqualität und Kontextfaktoren einbezieht.
Wo kann Wirkungsorientierung einfließen?

4. Was wird besser, wenn Wirkungsorientierung gelingt?
Wenn Wirkungsorientierung systematisch in Förderprogramme integriert wird, verändert sich der gesamte Steuerungsprozess – zum Vorteil aller Beteiligten:
- Fördermittel werden zielgerichteter eingesetzt, weil Ziele und Wirkungsannahmen frühzeitig geklärt werden.
- Programmverantwortliche gewinnen an Sprechfähigkeit – sie können fundiert über Fortschritte, Herausforderungen und Erfolge berichten.
- Ergebnisse lassen sich besser sichtbar machen und kommunizieren – nach innen wie nach außen.
- Probleme werden frühzeitig erkannt, weil Monitoringsysteme als Frühwarnsysteme dienen.
- Projekte profitieren voneinander, weil gemeinsame Zielsysteme Austausch und Peer Learning erleichtern.
- Evaluationen werden besser, weil die Datenbasis teilweise im Projektverlauf erhoben werden kann und so valider wird.
- Digitale Tools sorgen für effizientere Prozesse, z. B. bei Antragsprüfung und -bewilligung, Berichterstattung und Wirkungsmonitoring.
- Transparenz und Fairness steigen, weil Erwartungen offen und nachvollziehbar kommuniziert werden.
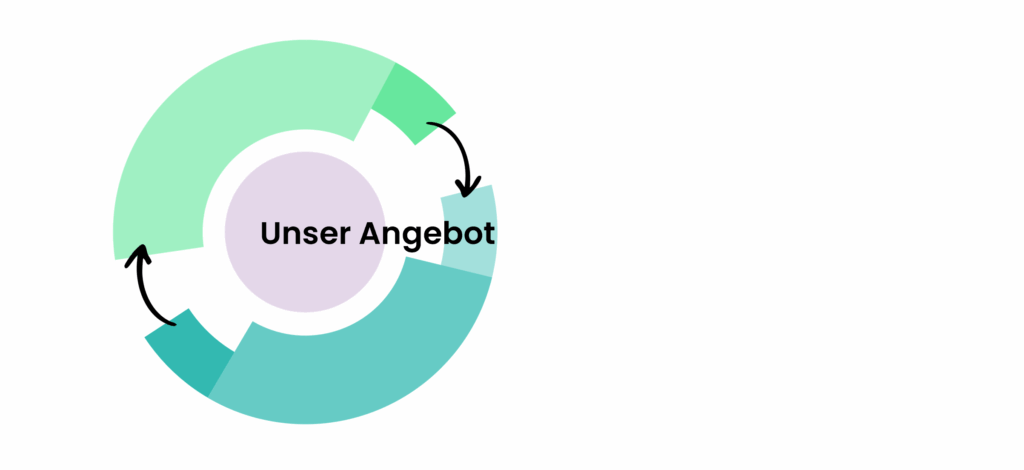
5. Wirkungsorientierung, die in der Praxis funktioniert
Wirkungsorientierung entfaltet ihr volles Potenzial nur dann, wenn alle relevanten Akteure mitgenommen werden – von der programmverantwortlichen Stelle über die Bewilligungsbehörde bis hin zu Projektträgern, Beiräten, Jurys und – sofern möglich – auch den Zielgruppen selbst. Wir begleiten diesen Prozess von Anfang an – fachlich fundiert, methodisch versiert und mit einem Gespür für die politischen, organisatorischen und praktischen Rahmenbedingungen.
Beratung und Konzeption
Wir unterstützen Fördermittelgeber:innen systematisch dabei, Wirkungsorientierung sinnvoll zu integrieren – dort, wo sie den größten Mehrwert bringt:
- Bei der (Neu-)Gestaltung von Förderrichtlinien – ob komplette Neufassung, Novellierung oder Ergänzung durch wirkungsorientierte Hinweise
- Beim Entwurf praxisnaher Indikatorenkataloge, die sowohl Steuerung ermöglichen als auch handhabbar bleiben
- Bei der Entwicklung von Antragsformularen – insbesondere bei Konzeptdokumenten und Vorlagen für Sachberichte
- Bei der Ausgestaltung von Auswahlkriterien, die auf Wirkung fokussieren und zugleich Vielfalt und Innovation zulassen
- In der Beratung von Projektverantwortlichen, die ihre Projekte wirkungsorientiert umsetzen möchten
Partizipative Prozesse: Wirkung gemeinsam denken
Wirkungsorientierung ist dann am tragfähigsten, wenn sie gemeinsam entwickelt wird. Wir moderieren Prozesse, die Beteiligung ernst nehmen:
- Workshops zur Entwicklung von Wirkmodellen, die realistisch, anschlussfähig und aufschlussreich sind
- Arbeitsphasen zur Entwicklung von Monitoringsystemen, die sowohl auf Projektebene als auch aggregiert funktionieren
- Vernetzungsformate, in denen Projektträger voneinander lernen, Herausforderungen offen teilen und gemeinsam an Lösungen arbeiten
Technische Umsetzung und Digitalisierung
Wirkungsorientierung braucht nicht nur Konzepte, sondern funktionierende Tools. Wir unterstützen bei der technischen Umsetzung – pragmatisch und skalierbar:
- Aufbau von Monitoringsystemen, mit einfachen Mitteln (wie Excel, Word) und durch Online-Umfragen oder auch mithilfe von spezialisierteren Tools.
- Digitalisierung von Berichts- und Antragsprozessen, die Zeit sparen, Qualität sichern und Transparenz erhöhen – für alle Beteiligten
IMAP Angebote zu Wirkungsorientierung im gesamten Prozess

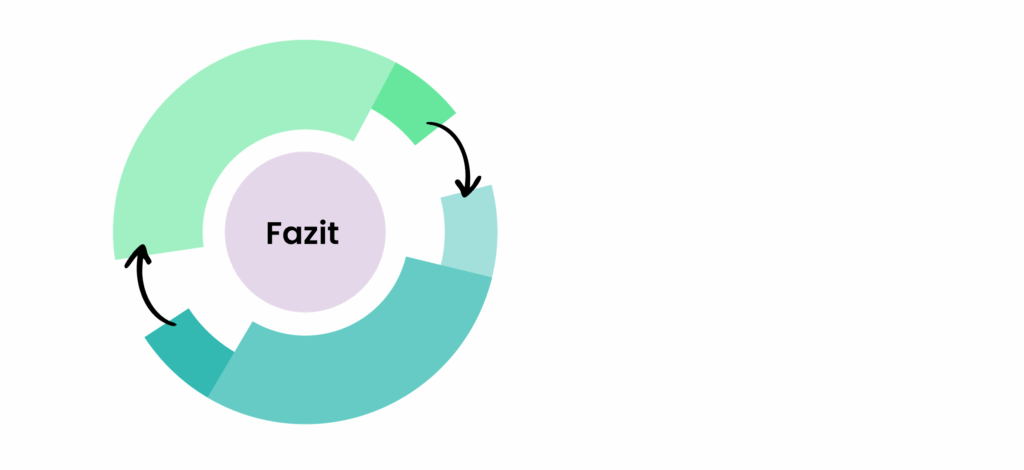
6. Wirkungsorientierung ist kein Selbstzweck – sondern Schlüssel für gewünschte Ergebnisse
Ob Klimaschutz, Bildung, Integration oder ländliche Entwicklung: Förderprogramme sollen etwas bewirken. Wirkungsorientierung hilft, diesen Anspruch greifbar zu machen – ohne die Komplexität der Realität zu ignorieren. Wer Förderung auf Wirkung ausrichtet, investiert nicht nur klüger, sondern verantwortungsvoller.